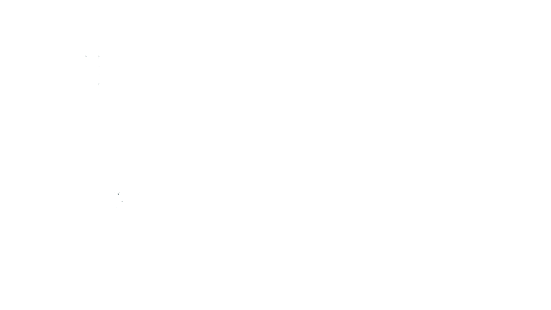Unsere Strecke durch Georgien haben wir so gewählt, dass wir möglichst nicht in zu hohe Höhen vorstossen und gleichzeitig auf den verkehrsarmen Nebenstrassen fahren. Abseits der Hauptverkehrsadern teilen wir die Strassen nur mit wenigen Autos. Diese fahren mit Vorliebe ohne Stossstange und manchmal auch gänzlich ohne Frontabdeckung herum und ermöglichen ungewohnte Einblicke in die Funktionsweise eines Autos.
Einen kleinen Abstecher in die Höhe gönnen wir uns aber und so fahren wir in das Minenstättchen Tschiatura. In Tschiatura wurde während über 150 Jahren intensiv Manganerz gewonnen. Um die verschiedenen Minenschächte und die Stadtviertel zu erschliessen, bedienen zahlreiche Gondelbahnen die Höhen rund um die Stadt. Der Name Tschiatura ist Programm: Übersetzt heisst er «Ein Wurm oder keiner» und bezieht sich auf die gewundenen Zufahrtsstrassen in die Stadt. Als Velofahrer lernt man schnell: Je stärker gewunden, desto steiler. Der Schnee schmilzt, die Wurmstrassen sind nass und so quietschen wir uns mit heruntergefahrenen Bremsklötzen die steile Strasse in das Stadtzentrum runter.
Wir ziehen an sowjetischen, zerschlissenen Wohnblöcken vorbei und auch das Stadtzentrum im Talfuss gibt kein viel freundlicheres Bild ab. In einer kleinen Beiz mit blubbernden Töpfen schaut man uns nur unverständlich an, als wir versuchen, etwas zu bestellen. Die Sonne scheint so gut sie kann, aber die Luftfeuchtigkeit lässt die Kälte schnell unter die Kleider kriechen. Die Seilbahnen laden zu einer Spassfahrt ein, aber irgendwie vermag uns diese Kleinstadt nicht in ihren Bann zu ziehen. Die Arbeiter, die sich neben dem Gemüsestand versammelt haben, wirken verbraucht und wärmen sich rauchend an kleinen, offenen Feuern. Der Geruch von Kohle und Diesel schwebt zwischen den Plattenbauten und wir beschliessen, uns für unsere nächste Übernachtung die unglaublich steile Wurmstrasse auf der Westseite der Stadt hochzukämpfen.
Sobald wir die gut 300 Höhenmeter bewältig haben, stellen wir fest, dass wir auf diese Weise die kalten, schweren Luftmassen tatsächlich etwas hinter uns lassen können. Unser perfektes Plätzchen erspähen wir wie so oft unabhängig voneinander: Eine stattliche Kirche thront etwas abseits des Dorfes auf einem Vorsprung und verspricht eine wunderbare Aussicht und eine ruhige Nacht.
Auf und ab geht die Fahrt am nächsten Tag bis die Strasse sich schliesslich gegen Norden wendet und wir bei Minustemperaturen durch ein hübsches, steifgefrohrenes Tal Richtung Chaschuri sausen. Das Tal scheint im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel zu sein; zum ersten Mal entdecken wir kleine Beizen am Strassenrand, die zum Verweilen einladen. Nach einer Stärkung mit- Überraschung: Katschapuri!- und wohl aus Mitleid gereichtem Schnaps, verlieren wir allmählich an Höhe und der Wald weicht einer offenen, steppenartigen Landschaft. Wir haben soeben eine Klimazone gewechselt!
Besonders gut sichtbar wird das am nächsten Tag bei der Einfahrt nach Gori. Von der Burg, die über der Stadt thront blicken wir in ein sandfarbenes hügliges Umland, welches sich in der Ferne zu hohen, schneebedekten Bergen auftürmt. Von der Burg aus erspähen wir einen Wochenmarkt und bald schon schlendern wir durch die bäuerlichen Auslagen. Warm eingemummelte Frauen bieten an, was ihr Garten oder Hof so hergibt: In Kübeln werden Äpfel angeboten, Kohl und Kräuter, Walnüsse in verschiedenen Preisklassen, getrocknete Pflaumen, Birnen und Persimon und der salzige, krümmelige Frischkäse, der vor dem Verzehr zuerst in heissem Wasser eingelegt werden sollte. Die Marktfrauen und Männer freuen sich über uns Ausländer und beschenken uns mit Mandarinen und interessierten Blicken und Gesten. Beim Anblick der Auslagen wird uns klar, warum Restaurants eine so selte Erscheinung sind hier: Die Menschen sind mehrheitlich Selbstversorger und vom Mais bis zum Speck und Käse wird alles auf dem eigenen Land oder in der nahen Umgebung hergestellt. Wildkräuter werden getrocknet und als Tee verwendet, Kräuter baut man ebenfalls selbst an und nahezu jede Familie stellt ihren eigenen Wein, Schnaps und Liquor her.
Bald erfahren wir, wofür Gori international bekannt ist: Ein gewisser Josef Stalin, sowjetischer Politiker und Diktator von Beruf, erblickte hier das Licht der Welt. Sein originales Geburtshaus wird im Zentrum der Stadt prominent präsentiert und hier treffen wir auf Mario, ein Norditaliener mit Wohnsitz in Tbilisi, der uns gleich zu sich in die WG einlädt, sobald wir dann in der Hauptstadt eintreffen.
Wir finden für umgerechnet 12 Franken ein grosszügiges Zimmer, waschen mal wieder unsere gesamte Wäsche und geniessen das Kochen auf einem richtigen Herd.
Nach einem weiteren kalten Nieselregentag in Gori nehmen wir die letzte Etappe nach Tbilisi unter die Räder. Die Sonne scheint und die Landschaft wird auf eine kahle Weise spektakulär. Die kargen Wiesen gaben genug her für die genügsamen Schafe und so entdecken wir hier wieder grössere Schafherden mit ihren Begleitmenschen, die über die Hügelketten ziehen. Eine halbwilde Pferdeherde galoppiert in der Abendsonne vor uns über die Strasse und verleiht der einsamen Gegend noch ein bisschen mehr Zauber. Wir zweigen ab auf einen Feldweg zu einer Antenne und da oben, auf dem höchsten Punkt der Hügelkette schlagen wir in einer Mulde unser Camp auf. Menschenleer, Baum leer, nur wir, die Sterne und die Antenne. Wir entdecken die Brennqualität von Schafskot und verbringen einen wunderbaren Abend am wärmenden Lagerfeuer.
Der folgende Fahrtag ist ein Kampftag. Der Gegenwind peitscht uns auch noch den letzten Schnudderfaden aus der Nase und lässt uns auch auf geraden Strecken in sehr tiefen Gängen strampeln.
Für unsere Mittagspause kaufen wir uns wie gewohnt ein ofenfrisches Schotibrot und setzen uns gleich neben der kleinen Strasse in die Sonne. Es dauert nicht lange, bis uns eine Familie zu sich in den Garten winkt. Da wir zuerst fertig essen wollen lehnen wir dankend ab und werden in der Folge mit selbstgemachten Churchhelas beschenkt. Mit dem Angebot «Coffee?» lassen wir uns schliesslich doch noch überzeugen und lassen uns in die warme Stube führen.
Der Kaffee ist eine Wohltat und die kurze Begegnung mit der Familie ebenso! Der Cousin aus Aserbaidschan ist sehr darauf bedacht, dass wir den familieneigenen Wein probieren und am liebsten würde er uns gleich noch einen grossen Orangenschnaps einschenken. Maka, die Mutter ist gelernte Krankenschwester. Doch für die 300 Lari (100 Fr.), die sie monatlich verdienen würde in Tbilisi, lohnt sich der Weg bei Weitem nicht. So ist sie wie so viele Frauen in Georgien vor allem mit der Selbstversorgung beschäftigt: Pflanzen, pflegen, ernten, einmachen, fermentieren, einlegen, Holz hacken, Tiere versorgen, Mahlzeiten zubereiten und so weiter. Der Vater Gocha nennt sich ebenfalls arbeitslos und geht stattdessen fischen. Bilder auf seinem Natel lassen erahnen, dass er diese Tätigkeit ziemlich profimässig betreibt und die Fische aus dem nahen Fluss gewinnbringend verkauft. Um das Wohnhaus zu erweitern, packen gleich alle selbst an. Aktuell wird vor dem Haus ein grosses Metalltor zusammengeschweisst und stolz deutet Gocha auf den frisch ausgebauten Kellerraum. Im Garten wohnen zurzeit auch noch die 13 Mastschweine. Dieses «Geschäftsmodell» ist ein beliebter (Neben-) Erwerb in Georgien. Für Kälber sieht die Erfolgsrechnung etwa so aus:
Für 7 Lari pro Kilogramm wird ein lebendes Kalb eingekauft. Das heisst für ca. 700 Lari kriegt man ein Kalb, lässt dieses bis zu 12 Monate lang das Gras in der Umgebung in Fleisch umwandeln und verkauft es dann für ca. 2500 Lari dem Metzger. Für weitere 500 Lari füttert man dem Tier zusätzlich noch etwas Mais oder Kraftfutter und erhöht so das «Erntegewicht». So ein schlachtbereites Tier bringt dann 150 bis 180 kg Fleisch auf die Waage. Viele Familien halten sich dieser Rechnung wegen neben ihrer Milchkuh noch einige Kälber. Gegen Abend stehen die zahlreichen Haustiere nach ihren selbständigen Futterfeldzügen jeweils vor ihrem Gartentor und warten auf Einlass für die Nacht.
Wir verabschieden uns von der Familie und nach einer abgeschiedenen Nacht mit wunderbarem Lagerfeuer im Nationalpark Tiblisi, lassen wir uns vom Rückenwind in die Hauptstadt pusten.